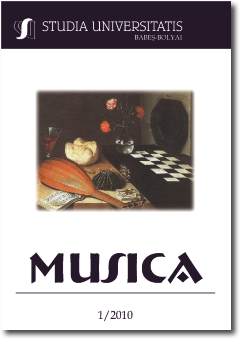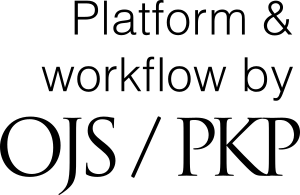ÉVA PÉTER, Musiktheorie, Napoca Star Verlag, Klausenburg / Cluj-Napoca, 2009
Abstract
Die Notwendigkeit der geistigen und konzeptuellen Erfassung der klanglichen Substanz veranlasst Einen - der danach strebt, sich in der Praxis der Musik zu vertiefen - dazu, die Phänomene der Musikpraxis in ein optimales theoretisches System zusammenzufassen. Die Grundsteine dieser Lehre wurden schon im Altertum von den ersten griechischen Musiktheoretikern anhand der Zahlenzusammenhänge, die (auch) als Grundlage der klingenden Musik dienen, gelegt. Allgemein bekannt sind die Untersuchungen der Pythagoreer, die auf den Zahlenverhältnissen der Konsonanzen beruhten, und auch mit ethischen und religiösen Zielen verbunden waren. Aristoxenos war derjenige, der die bislang wissenschaftlichen Argumentationen in ein System zusammenfasste und damit den wissenschaftlichen Rang der Disziplin fundamentierte. Selbst das Mittelalter betrachtete die Musiktheorie, mit Recht, noch als mathematische Disziplin. Allmählich wurde jedoch auch die erst einstimmige dann mehrstimmige (künstlerische) Gesang-praxis damit gleichrangig. Ohne dieses Geflecht und diese gegenseitige Beeinflussung der musiktheoretischen Lehre und der Gesang- und Musikpraxis wäre die Entwicklung von der Etablierung der Mehrstimmigkeit hin zur zeitgenössischen Musik unvorstellbar gewesen. Man denke hier vor allem an die Errungenschaften beginnend mit der Lösung der Musik-notenschreibung oder der Wirkung der Werke von Zarlino und Rameau hin zu den theoretischen Erkenntnisse von Schenker.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2010 Studia Universitatis Babeș-Bolyai Musica

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.